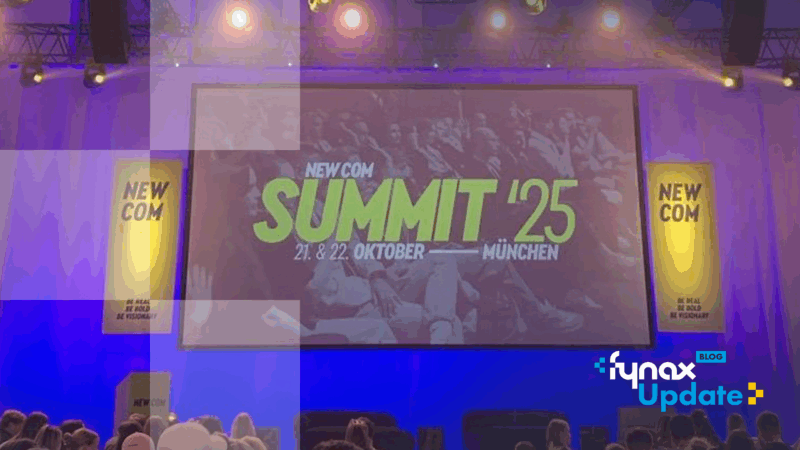Wie chinesische Onlinehändler:innen den europäischen Zoll austricksen
Diesen Artikel teilen
Kategorien

Billigplattformen aus China stellen nicht nur die Paketlogistik in Europa vor große Herausforderungen. Die Zollbehörden sehen sich mit der Flut an Sendungen aus Fernost zunehmend überfordert. Im Jahr 2024 gelangten durchschnittlich zwölf Millionen Päckchen täglich unter der Zollgrenze von 150 Euro in die EU. Um diese Grenze zu untergehen, setzen chinesische Online-Händler:innen systematisch und weit verbreitet dreiste Tricks ein. Hier erfahrt ihr, wie dabei vorgegangen wird, wie der Zoll damit umgeht, welche Auswirkungen dies auf Europa hat und was die EU-Kommission dagegen unternehmen will.
Die Entwicklung im Überblick
Der Online-Handel mit Waren unterhalb von 150 Euro, die direkt durch Verbraucher:innen in die EU eingeführt wurden, hat in den letzten Jahren extrem zugenommen. Waren es 2022 etwa 1,4 Mrd Sendungen, stieg die Zahl 2023 auf etwa 2,4 Mrd (davon 1,9 Mrd aus China) und explodierte 2024 auf knapp 4,6 Mrd Päckchen (4,17 Mrd aus China). Rund zwanzig Prozent des Aufkommens sind an deutsche Kund:innen adressiert.
Insbesondere Temu, AliExpress und Shein haben auf dem EU-Markt ein exponentielles Wachstum verzeichnet und im Jahr 2024 innerhalb weniger Monate mehr als 75 Millionen Nutzer:innen aus der EU angezogen. Der schnelle Anstieg der Einfuhren bringt erhebliche Herausforderungen mit sich, welche dringend gelöst werden müssen. Angefangen von Luftfrachtlogistik und Zollkontrollen bis zur Lieferung an die Endkund:innen und die steigende Umweltbelastung. Nicht zuletzt gilt es den Handel mit Produkten zu unterbinden, die nicht im Einklang mit EU-Rechtsvorschriften stehen. Wir haben uns bereits mit den Untersuchungen der EU zu illegalen und gefährlichen Produkten bei Temu und AliExpress beschäftigt.
Wie sehen die gängigsten Tricks aus
Eine zentrale Rolle spielt der belgische Regionalflughafen Lüttich, über den täglich mehr als eine Million Pakete aus China nach Europa gelangen – auch viele davon mit dem Ziel Deutschland. Der Flughafen wird dabei gezielt von den Billigplattformen genutzt, weil die dortigen Zollbehörden angesichts der schieren Masse an Sendungen kaum jede einzelne untersuchen können. Dabei kontrollieren knapp 200 Zollbeamte den Paketverkehr aus Fernost. „Wir werden mit Waren geflutet“, sagt Teamleiter Thomas José vom belgischen Zoll. „Wir wissen, dass die Versender bei den Wertangaben betrügen. Wir können aber nicht alles kontrollieren.“
Genau diese bewusste Falschangabe ist ein sehr häufig genutzter Trick. So wird etwa ein Päckchen mit einem tatsächlichen Wert von über 500 Euro als Sendung im Wert von 50 Euro deklariert. Damit umgehen die Händler:innen die Zollgebühren, die ab einem Warenwert von 150 Euro fällig wären und führen eine zu geringe Einfuhrumsatzsteuer ab. Zollbeamte bestätigen, dass es sich hierbei um gezielten Betrug handelt und dass sich die Versender dessen sehr wohl bewusst sind.
Ein weiterer, besonders perfider Trick besteht darin, eine Bestellung mit einem Gesamtwert von über 150 Euro auf mehrere Sendungen zu verteilen. Diese Päckchen werden häufig an unterschiedlichen Tagen und teils sogar über verschiedene Absenderadressen verschickt, um den Eindruck unabhängiger Warenströme zu erwecken. Dadurch wird nicht nur Zoll- und Steuerbetrug begangen, sondern die Gesamtzahl der Päckchen noch weiter nach oben getrieben, was wiederum zu mehr Frachtverkehr führt und so auch aus ökologischer Sicht fatal ist.
Parallel dazu werden irreführende Bezeichnungen wie „technische Ausrüstung“ oder „Dokumente“ verwendet, um eine routinemäßige Kontrolle zu vermeiden. Die unspezifischen Klassifizierungen sollen bewusst irritieren und die Wahrscheinlichkeit senken, dass ein Paket genauer geprüft wird. Inzwischen kommen auch eigene Logistiknetzwerke und Kooperationen mit Partnern zum Einsatz, die Waren teilweise über Drittstaaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder die Türkei umleiten. Auf diese Weise werden vorab potenzielle Hindernisse ausgeblendet und die tatsächliche Herkunft verschleiert.
Auswirkungen auf Handel, Staat und Verbraucher
Die Folgen dieser betrügerischen Praktiken sind weitreichend. Europäische Online-Händler:innen, die sich an die geltenden Zoll- und Steuerregelungen halten, sehen sich mit massiver Wettbewerbsverzerrung konfrontiert. Sie suchen zunehmend nach eigenen Lösungen und reagieren strategisch und strukturell auf die Herausforderungen. Viele setzen bewusst auf geprüfte Produkte mit CE-Kennzeichnung, nachvollziehbare Lieferketten, transparente Rückgabebedingungen und hochwertigen Kundenservice. So positionieren sie sich als vertrauenswürdige Alternative zu Billigplattformen, deren Produkte oft mangelhaft oder unsicher sind.
Auch Handelsverbände und Verbraucherschützer:innen beklagen seit langem die unlauteren Praktiken. Sie erhöhen den Druck auf die EU, dagegen vorzugehen und die europäischen Online-Händler:innen besser zu unterstützen und zu schützen. „Im europäischen Binnenmarkt müssen endlich gleiche Regeln für alle Marktteilnehmer gelten“, erklärte Stephan Tromp, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE).
Verbraucher:innen wiederum erhalten oft minderwertige Produkte ohne CE-Kennzeichnung oder ausreichende Sicherheitszertifikate. „Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich immer darüber im Klaren sein, wenn man günstig Ware aus China einkauft, dann ist das natürlich nicht nachhaltig.“ sagt Iwona Husemann, Juristin bei der Verbraucherzentrale NRW. Im Schadensfall gestaltet sich auch die Rückabwicklung kompliziert. Garantieansprüche sind schwer durchzusetzen, und die fehlende Produkthaftung birgt Risiken für Gesundheit und Sicherheit.
Letztlich sind alle EU-Bürger:innen von den Betrügereien betroffen. Staatlichen Kassen entgehen durch die entfallenen Abgaben Milliardenbeträge, die beispielsweise für Infrastruktur, steuerliche Entlastung oder soziale Leistungen fehlen.
Die EU sucht Wege zu mehr Transparenz und Fairness
In einer Pressemitteilung hat die EU-Kommission dargestellt, wie Sie die betrügerischen Praktiken unterbinden und den ungerechten Wettbewerb eindämmen will. Dafür sind koordinierte Maßnahmen auf EU-Ebene unverzichtbar. Es wurde ein Reformpaket eingebracht, das den Wegfall der Zollbefreiung für Sendungen unter 150 Euro Warenwert vorsieht. Des Weiteren soll eine Bearbeitungsgebühr eingeführt werden, um die Kosten für die Überwachung zur Einhaltung der EU-Vorschriften solcher Sendungen zu senken. Die Kontrollkapazitäten sollen gestärkt werden, z. B. durch eine bessere gemeinsame Nutzung von Daten und eine optimierte Risikobewertung.
Einheitliche Zollfreigrenzen, strengere Stichprobenkontrollen und besserer Informationsaustausch zwischen den Mitgliedsstaaten würden die Schlupflöcher im System deutlich verkleinern. Gleichzeitig müssen Verbraucher:innen stärker aufgeklärt werden, worauf sie bei Bestellungen aus dem Nicht-EU-Ausland achten sollten. Hinweise auf CE-Kennzeichen, detaillierte Warenbeschreibungen und transparente Versandkosten wären erste Schritte, um mehr Vertrauen in den grenzüberschreitenden Online-Handel zu schaffen.
Die EU-Kommission ruft Mitgliedstaaten, Co-Gesetzgeber und alle Interessengruppen zur engen Zusammenarbeit auf, um die in der Pressemitteilung beschriebenen Maßnahmen umzusetzen. Innerhalb eines Jahres wird sie die Wirkung der verstärkten Kontrollen bewerten und einen Bericht zu den Ergebnissen veröffentlichen. Auf Basis dieser Bewertung prüft die EU-Kommission gemeinsam mit nationalen Behörden, ob weitere Rechtsakte oder Durchsetzungsmaßnahmen notwendig sind, um die Einhaltung europäischer Vorschriften zu sichern.
Fazit
Die günstigen Angebote aus China suggerieren vermeintliche Schnäppchen, doch der Preisvorteil entsteht oft auf Kosten von Fairness, Sicherheit, Umwelt und staatlichen Einnahmen. Die kombinierten Tricks durch Paketaufteilung, falsche Deklaration und gezielte Nutzung von Frachtdrehkreuzen zeigen, wie ausgeklügelt viele Online-Händler:innen aus Fernost vorgehen. Nur durch eine enge Zusammenarbeit von Behörden, Verbraucherschützer:innen und Plattformbetreiber:innen kann der faire Wettbewerb im internationalen Handel wiederhergestellt werden. Bis dahin gilt es für europäische Verbraucher:innen und Online-Händler:innen wachsam zu sein, um unseriöse Praktiken zu erkennen und ihnen entgegenzutreten.